Verschwörungstheorien entlarven
Das Internet wird zunehmend zum Sammelbecken für die wildesten Verschwörungstheorien. Von der angeblich nur inszenierten Mondlandung bis zur Entführung von Elvis Presley durch Außerirdische oder ab 2020 auch der Leugnung unterschiedlichster, wissenschaftlich erwiesener Tatsachen zur Coronapandemie – alles nur Spinnerei? Natürlich – alles nur Gerüchte. Aber die zunehmende Faszination für irrationale, unwissenschaftliche Weltbilder ist gefährlich. Für den Einzelnen wie für die Gesellschaft. Schuld daran ist auch die Technik.
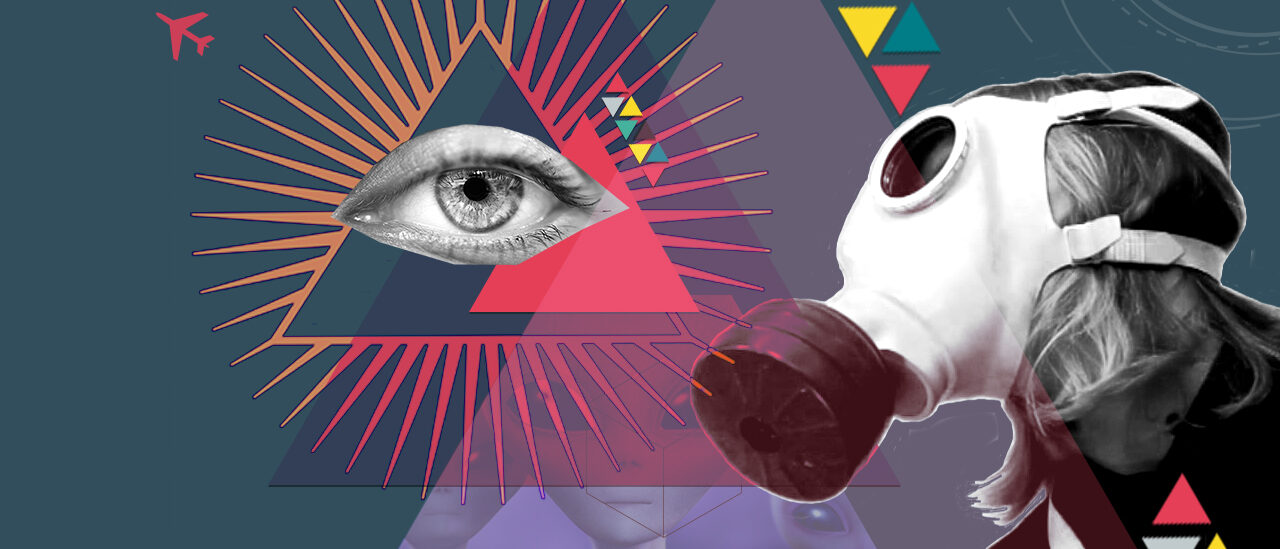
27.02.2021
Gefangen in Suchergebnissen
Soziale Netzwerke und Suchmaschinen verwenden Formeln, mit denen der oder dem User*in stets nur immer mehr vom immer Gleichen, also gefilterte Ergebnisse angezeigt werden. Resultat ist die sogenannte Filterblase. Sie lässt zunehmend eine abgeschlossene ideologische Kapsel entstehen, also ein geschlossenes Weltbild, in dem nur noch Inhalte angeboten werden, die zur Theorie passen.
Die einzelnen Verschwörungstheoretiker*innen verstehen sich als Teil eines exklusiven Kreises von Wissenden und im Gegenzug wird jede*r Kritiker*innen als Komplize des verfeindeten “Systems” angesehen. Die Expert*innen von der Berliner Initiative “Goldener Aluhut”, die über Verschwörungsideologien aufklären, sprechen von sektenähnlichen Mechanismen.
Beweise statt Verschwörungstheorien
Unter Verschwörungstheoretiker*innen steigt das Misstrauen in staatliche Institutionen, unabhängige Presseorgane. Rundfunkanstalten werden als “Lügenpresse” abgestempelt. Doch wenn so die Glaubwürdigkeit der freien Presse grundsätzlich in Frage gestellt wird, ist das auch eine Gefahr für die Demokratie. Was dagegen hilft? Vermutlich nur die Besinnung auf die journalistischen Grundtugend: Beweise.
Wie funktionieren Verschwörungstheorien? Und warum gibt es die überhaupt? Die wichtigsten Fakten in einem kompakten Überblick.
Funktionen von Verschwörungstheorien
Die Sündenbockthese wird in den meisten Fällen als politisches Kampfmittel gegen Gruppen angewandt, nicht selten gegen Minderheiten. Entweder wird ein Sündenbock für einen speziellen Vorfall oder ein spezielles Unglück gesucht. Oder es geht lediglich darum, die eigene aggressive und ablehnende Haltung und Handlung zu rechtfertigen. Es kann aber auch vorkommen, dass der Sündenbock für etwas Spezielles gesucht wird. Aus dem egozentrischen Eindruck “Alle sind gegen mich” entwickelt sich eine Identifizierung des Bösewichts: “SIE sind gegen mich”.
Die Verschwörungstheoretiker*innen reagieren dabei auf gesellschaftlich traumatisierende Ereignisse. Die naheliegende Erklärung des Ereignisses erscheint zu einfach.
Kennedy – “Ein Präsident kann doch nicht einfach von einem Irren erschossen werden!”
9/11 – “Es kann doch nicht einfach jede*r Terrorist*in ein Flugzeug besteigen und in ein Hochhaus steuern!”
Die Coronapandemie – “Es gibt kein Corona!” / “Während der Corona-Impfung wurden wir alle gechipt!”
Der Schrecken des Vorfalls ist deshalb schwerer zu verarbeiten. So werden die Ereignisse nicht wie sonst vereinfacht, sondern verkompliziert und stattdessen durch immer komplexere Gedankengebäude und Erklärungsmodelle angereichert.
Die Wissenschaften sind in fast jeden Bereich des Lebens vorgedrungen. Trotzdem gibt es immer noch Phänomene, Gerüchte und Ereignisse, die etwas Geheimnisvolles umgibt, die dort, wo Wissenschaft Lücken lässt, einer Erklärung bedürfen. Als Erklärung dient dann nicht selten das Wirken einer Gruppe im Hintergrund.
Ursachen für Verschwörungstheorien
Die oder der Verschwörungstheoretiker*in ist oft auf der Suche nach ideologischer und weltanschaulicher Heimat. Als “Einstiegsdroge” für Verschwörungsideologien aller Art dient nicht selten ein spektakulärer Fake, der der oder dem Leser*in oder Hörer*in einen Sachverhalt bzw. ein Ereignis in einem völlig neuen Zusammenhang schildert. Bei der intensiven Suche nach Informationen zum Thema landet sie oder er auf einschlägigen Webseiten oder bei Literatur mit einer etwas befremdlichen Logik. So schreiben Verschwörungstheoretiker*innen gerne voneinander ab: Sie verfassen Bücher, die wiederum selbst von Verschwörungstheoretiker*innen gelesen und sodann in deren eigenen Büchern zitiert werden. Wer die Bücher liest, wird schnell feststellen, dass gleiche Zusammenhänge in gleicher Weise von unterschiedlichen Personen geschildert werden. So entsteht häufig der Eindruck, dass zwei unabhängige Personen zum selben Ergebnis gekommen wären.
Zu dieser Form der Informationsinzucht kommt die psychologische Eigenart, widersprüchliche Informationen kategorisch abzublocken, bestätigende Informationen dagegen schnell aufzunehmen. Dieser Widerspruch wird auch durch die technischen Funktionsweisen von Internet-Suchmaschinen oder Sozialen Netzwerken verstärkt, deren Algorithmen dafür sorgen, dass bestimmte Informationen je nach bisherigem Suchverlauf und Interessen selektiert und aussortiert werden und man in einer Meinungs- und Filterblase gefangen ist, in der man immer mehr vom immer gleichen erfährt.
Das Weltbild von Verschwörungstheoretiker*innen wird so zunehmend durch irrationale Verdächtigungen und Ängste bestimmt. Vor allem im Netz entwickeln Online-Gemeinschaften (Communities) schnell ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl und elitäres Gruppenbewusstsein. Neu-“Gläubige” fühlen sich mittels love-bombing (“Hey, toll dass du endlich zu uns gehörst”) und einer starken Abgrenzung nach außen auch emotional verstanden und aufgehoben. Expert*innen sprechen nicht selten von sektenähnlichen Mechanismen.
Beispiele für Verschwörungstheorien
Behauptung: Jedem, der den Himmel beobachtet, fällt auf, dass es da oben nicht nur normale Kondensstreifen gibt. Und früher waren die auch nicht so langlebig.
Gegenargument: Nach Aussagen unterschiedlicher wissenschaftlicher Fachleute können alle Beobachtungen an Kondensstreifen als normale Wetterphänomene erklärt werden.
Behauptung: Im Vergleich zu früher ist der Himmel heute oft von Kondensstreifen übersät. Chemtrails sollen das Wetter beeinflussen. Wenn viele Kondensstreifen zu sehen sind, ändert sich das Wetter.
Gegenargument: Im Vergleich zu früher haben sich ja auch die weltweiten Flugbewegungen vervielfacht. Außerdem kann man anhand der Kondensstreifen tatsächlich das Wetter vorhersagen. Das liegt an natürlichen Vorgängen in der oberen Atmosphäre, die sowohl Langlebigkeit und Aussehen von Kondensstreifen als auch das kommende Wetter beeinflussen.
Behauptung: Untersuchungen haben das Vorkommen von giftigen Stoffen durch Chemtrails in Luft und Wasser bestätigt. Offizielle Stellen sind manipuliert und unglaubwürdig. Nur unabhängige Untersuchungen können Aufklärung verschaffen.
Gegenargument: Wissenschaftler*innen und Behörden, die laufend Messungen durchführen und die Luftverschmutzung überwachen, fanden bisher nichts, was die Chemtrail-Theorie stützen würde. Würden all diese Akteur*innen flächendeckend bewusst falsch berichten, müsste es sich um eine gigantische Verschwörung handeln. Eine “unabhängige” Untersuchung könnten die Chemtrail-Gläubigen übrigens leicht selbst durchführen. Die Kosten für einen Wetterballon und die nötige Ausrüstung betragen nur rund 500 Euro.
Die meiste mediale Aufmerksamkeit im Bereich Verschwörungstheorie bekommen in Deutschland aktuell die sogenannten “Reichsbürger*innen”. Dabei handelt es sich um eine meist rechtskonservative politische Verschwörungsideologie, die den deutschen Rechtsstaat nicht anerkennt. Das deutsche Reich sei nie untergegangen, die Bundesrepublik lediglich eine GmbH, das Grundgesetz nicht gültig und Deutschland seit dem 2. Weltkrieg ein besetztes Land.
Jedes dieser Argumente wurde in ausführlichen Stellungnahmen von unterschiedlichen Jurist*innen sowie Verwaltungs- und Verfassungsrechtler*innen widerlegt. Bei den Reichsbürger*innen gibt es zahlreiche personelle und ideologische Schnittmengen mit der Pegida-Bewegung, der AFD-Partei sowie der Auffassung, dass (vornehmlich öffentlich-rechtliche) Journalist*innen nicht der wahrheitsgemäßen Berichterstattung verpflichtet, sondern politisch manipuliert sind und als publizistische Marionetten die Interessen höherer Mächte (CIA, USA etc.) vertreten.
Reichsbürger*innen weigern sich oftmals, Steuern zu zahlen und verkaufen eigene Dokumente und Ausweise. Widerstandshandlungen oder Aggressionen gegen Vertreter*innen von Staat und Justiz fanden ihren tragischen Höhepunkt im Oktober 2016, als ein selbsternannter Reichsbürger auf Polizisten schoss und einen SEK-Beamten tötete.
Wie sich Lügen im Netz verbreiten
n vielen sozialen Netzwerken, wie z. B. Facebook, muss niemand mit seinem richtigen Namen erscheinen. Auch in vielen anderen Netzwerken und Plattformen ist es möglich, anonymisiert aufzutreten bzw. seinen Klarnamen und seine wahre Identität hinter einem “Avatar”, also einer künstlichen / erfundenen Figur oder einem “Nickname” zu verstecken. Gerade bei Facebook oder Telegram verschleiern viele ihren richtigen Namen mit Abkürzungen oder absichtlichen Fehlern.
Verboten ist das nicht. Je nach Netzwerk kann es aber einen Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen des Anbieters bedeuten. Die Konsequenz könnte eine Sperrung des Accounts sein. Anders liegt der Fall, wenn ein Name (quasi) missbraucht wird und unter diesem Namen Texte oder Bilder veröffentlicht werden. Durch das Recht am eigenen Namen muss somit jemanden, der sich also z. B. bei Twitter als Justin Bieber ausgibt unter Umständen mit Post vom Anwalt rechnen. Es hat sich jedoch herauskristallisiert, dass Großteile der Social Media-Konzerne, wie das berits genannte Facebook, sich selbst kaum die Mühe machen Straftaten wie diesen nachzugehen. Plattformen wie Telegram sind sogar dafür bekannt, einen sicheren Raum zu bieten, um ungehindert in Foren, einem virtuellen Platz zum Austausch und zur Archivierung von Gedanken, Meinungen und Erfahrungen, Hassreden und Verschwörungstheorien unter falschem oder anonymisierten Namen zu verbreiten.
Wer mehr über die Quelle von bestimmten Aussagen und den damit verbundenen Aussagen erfahren möchte, sollte einen Blick auf das Impressum werfen. Dort wird angegeben, wer sich inhaltlich für die Webseite verantwortet. Nicht selten gibt es dabei interessante Entdeckungen, wer wirklich hinter der ein oder anderen Homepage steckt und welche Gesinnung die- oder derjenige hat.
Wer als Journalist*in ernst genommen werden möchte, wird seine Texte im Internet mit seinem Klarnamen und nicht anonymisiert veröffentlichen.
Auch wenn viele, bevor sie im Internet oder in den sozialen Medien etwas schreiben, nicht besonders lange darüber nachdenken: Auch im Netz gelten die Gesetze. Das bedeutet: Beleidigungen können und werden bestraft. Ob dabei das Schimpfwort oder der Kraftausdruck jemandem per Privatnachricht verschickt oder öffentlich gepostet wird, ist nicht relevant, da der Inhalt betrachtet wird. Das ist gerade beim Thema “Shitstorm” zu beachten. Ein*e Politiker*in macht einen Fehler, eine Torwärt oder ein Torwart greift daneben – und schon bricht im Internet ein Shitstorm, eine Welle an Beleidigungen, über sie oder ihn herein.
Sachliche Kritik ist völlig in Ordnung, Beleidigungen oder falsche Behauptungen nicht. Wo genau die Grenze verläuft, wird rechtlich unterschiedlich bewertet, denn es hängt auch davon ab, wie prominent die Person ist, die beschimpft wird. Personen des öffentlichen Lebens, also Sportler*innen, Politiker*innen oder Stars müssen sich mehr gefallen lassen. Ein Freibrief ist das aber nicht. Auch hängt die Anzahl der Beleigiungen und das Thema der Beleidigung auch davon ab, welchem Geschlecht sich die Person selbst zuordnet oder zugeordent wird. Denn vor allem Frauen werden im Netz häufiger belästigt – und das oft auch sexuell.
Wenn das Foto selbst geschossen wurde und wenn alle, die auf dem Foto abgebildet sind, der Veröffentlichung zugestimmt haben, kann das Bild ohne Probleme online gestellt werden. Denn Bilder dürfen nur dannn Bilder hochladen, teilen oder weiterleiten, wenn die- oder dejenige die Nutzungsrechte besitzt. Und wenn sie nicht gegen die Persönlichkeitsrechte anderer, also das persönliche Recht am eigenen Bild, verstoßen. Wer sich nicht daran hält, kann sich eine Abmahnung wegen Urheberrechtsverletzung einhandeln.
Wer zu leichtfertig fremdes Bild- oder Videomaterial teilt, macht sich strafbar.
Mehr zu Fake News
Weitere Beiträge
Medienlabor Bibliothek – (Politische) Medienkompetenz für Erwachsene
Das Projekt „Medienlabor Bibliothek“ stärkt durch eine modulare Weiterbildung Bibliothekarinnen und Bibliothekare darin, Medien- und politische Kompetenzangebote für bislang unterversorgte erwachsene Zielgruppen zu entwickeln und umzusetzen, um Desinformation und demokratiegefährdenden Entwicklungen entgegenzuwirken. Mehr

Schülermedienpreis 2026: Jetzt noch bewerben!
Der Schülermedienpreis Baden-Württemberg geht in eine neue Runde. Jetzt mitmachen und Preise im Gesamtwert von rund € 8.000 gewinnen! Bewerbungsschluss ist der 25. Januar 2026. Mehr

Landtagswahl 2026: Ein Guide für Erstwähler
Zwei Stimmen statt einer, wählen ab 16 Jahren, mehr Möglichkeit der Repräsentation: Am 8. März 2026 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Mehr